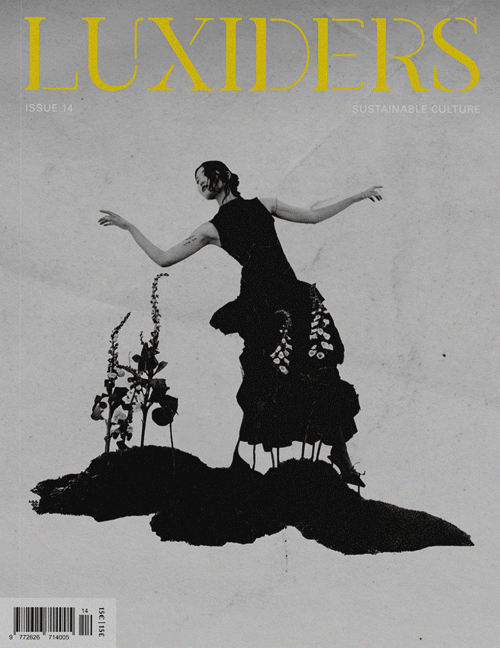Der Aufstieg von Science-Washing in Beauty und Wellness | Wenn Marken Wissenschaft vortäuschen
In einer Welt, die in Fachjargon untergeht – „klinisch erwiesen“, „wissenschaftlich getestet“, „von Dermatologen empfohlen“ – gewinnt eine subtile Täuschung zunehmend an Boden: Science-Washing. Dabei handelt es sich nicht um Greenwashing (irreführende Umweltversprechen), sondern um eine verwandte Taktik: Marketing wird in den Anschein von Wissenschaft gekleidet. Die Wirkung ist dieselbe – Konsument:innen glauben an eine Fassade von Legitimität, die oft keine echte Grundlage hat.
Der Aufstieg von Science-Washing
In einer Welt, die von „wissenschaftlich belegten“ Produkten besessen ist, hat sich leise eine neue Form der Täuschung durchgesetzt: Science-Washing. Dabei leihen sich Marken die Sprache, Symbole und Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, damit ihre Produkte wirksamer — oder ethischer — klingen, als sie es tatsächlich sind. So wie sich „Greenwashing“ hinter Nachhaltigkeitsversprechen versteckt, verbirgt sich Science-Washing hinter dem weißen Laborkittel.
Laut einem Beitrag von wissenschaftskommunikation.de lässt sich Science-Washing definieren als „eine vorsätzliche Handlung, wissenschaftliche Praktiken oder Qualitätssicherung zu simulieren, um andere zu täuschen“. In den Bereichen Beauty, Wellness und Ernährung zeigt sich das in vagen Behauptungen — „klinisch erwiesen“, „dermatologisch getestet“, „wissenschaftlich formuliert“ —, die häufig keine unabhängigen Belege haben. Eine Studie aus dem Jahr 2024 von Foley & Lardner LLP hebt hervor, dass viele Beauty-Unternehmen wissenschaftliche Sprache missbrauchen, um ohne Transparenz Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Diese Taktiken nehmen zu, da Verbraucher:innen — besonders jüngere — nach Belegen, Leistung und Sinnhaftigkeit verlangen. Die Ironie: Je stärker die Menschen Wissenschaft einfordern, desto öfter wird sie von Marken vorgetäuscht.


Warum Science-Washing der Generation Z schadet
Science-Washing ist nicht nur ein cleverer Marketingtrick. Es ist eine Manipulation, die unverhältnismäßig stark die Generation Z – und besonders Frauen – trifft, zwei der am stärksten adressierten und digital vernetzten Zielgruppen.
Gen Z lebt in sozialen Medien, wo kurze Videos, Influencer-Aussagen und glatte „Lab-Style“-Brandings dominieren. Formulierungen wie „klinisch untermauert“ oder „bewährte Formel“ können schnell viral gehen und ein Gefühl von Legitimität verbreiten, das nur wenige überprüfen.
Laut Science in Poland fällt es vielen Konsument:innen schwer, echte Forschung von pseudowissenschaftlichem Marketing zu unterscheiden. Wird „Wissenschaft“ poliert und vereinfacht präsentiert, ist Vertrauen leicht – besonders, wenn Schönheit, Jugend oder Wellness versprochen werden. Für Frauen gehen die Folgen über verschwendetes Geld hinaus. Als „klinisch bewiesen“ beworbene Anti-Aging-Cremes oder Produkte zur hormonellen Balance können Inhaltsstoffe enthalten, deren Wirkung unbestätigt oder sogar riskant ist. Das falsche Versprechen „wissenschaftlicher Sicherheit“ kann echte Gefahren verschleiern.
Je häufiger Konsument:innen getäuscht werden, desto schwerer fällt es, echter Wissenschaft zu vertrauen. Wenn Marketing die Sprache der Forschung ausnutzt, verwischt es die Grenze zwischen Tatsache und Fiktion — und untergräbt das Vertrauen in Wissenschaftler:innen, Studien und sogar die Medizin selbst.

Skandale, die gefälschte Wissenschaft entlarvten
Klage gegen „Clean at Sephora“: 2024 sah sich Sephora einer Sammelklage gegenüber, der zufolge das Label „Clean at Sephora“ Kund:innen irreführend glauben ließ, Produkte seien vollständig frei von synthetischen oder schädlichen Inhaltsstoffen. Das Gericht wies die Klage ab, doch sie löste eine globale Debatte darüber aus, wie Händler „clean“ oder „wissenschaftlich“ definieren. Bereits 2023 reichte eine Klägerin (Lindsay Finster) eine Sammelklage ein und argumentierte, die Produktlinie impliziere, frei von sämtlichen synthetischen oder schädlichen Stoffen zu sein — obwohl einige Inhaltsstoffe enthalten waren, die Konsument:innen als nicht „clean“ einstufen könnten. Im März 2024 wies ein US-Bundesgericht die Klage ab mit der Begründung, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass „vernünftige Verbraucher:innen“ in die Irre geführt würden, und Sephora habe keine über den definierten „clean“-Standard hinausgehenden ausdrücklichen oder impliziten Zusagen gemacht. Der Fall zeigte, wie vage Begriffe wie „clean“ sein können — und dass Gerichte mitunter auf die vom Unternehmen gesetzten Grenzen zurückgreifen (Sephora definiert „clean“ etwa über Ausschlusslisten wie Phthalate oder Formaldehyd, nicht über ein generelles Verbot aller Synthetik). Selbst große Händler können also wegen mehrdeutiger „wissenschaftlicher“ Sprache in die Pflicht genommen werden, ihre Marketingaussagen zu präzisieren.
PFAS in „sicheren“ Kosmetika: Große Marken wie L’Oréal und Coty wurden beschuldigt, Produkte als „clean“ und „umweltfreundlich“ zu vermarkten, obwohl sie PFAS enthalten — sogenannte „Forever Chemicals“, die mit Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht werden. PFAS sind schwer abbaubare Chemikalien, zu denen es vermehrt Sammelklagen und Betrugsvorwürfe gibt, weil insbesondere „wasserfeste“ oder langhaftende Formulierungen PFAS enthalten könnten, ohne dass dies im Zutatenverzeichnis ausgewiesen ist. So erhebt etwa eine Klagewelle zu „Waterproof Makeup & PFAS“ den Vorwurf, einige Kosmetika enthielten nicht deklarierte PFAS und Hersteller hätten die Sicherheit falsch dargestellt. Mit zunehmender regulatorischer Prüfung müssen Kosmetikunternehmen die Lücke zwischen dem Marketingversprechen „sicher/ungiftig“ und der Realität chemischer Analysen und Offenlegung schließen. Reuters stellte jüngst fest, dass PFAS-Klagen ein wachsendes Risiko für die Körperpflegebranche darstellen. Aussagen wie „clean“, „safe“ oder „non-toxic“ müssen der Überprüfung durch echte Chemie-Tests standhalten — nicht nur dem Schein wissenschaftlicher Sprache. Haar-Relaxer und versteckte Gesundheitsrisiken: L’Oréals „Dark & Lovely“-Relaxer stehen im Zentrum von Klagen, die behaupten, die langfristige Anwendung habe Gebärmutterkrebs und reproduktive Gesundheitsprobleme verursacht. Die Klägerinnen argumentieren, das Unternehmen habe Sicherheit mit einem wissenschaftlichen Anstrich beworben und gleichzeitig wachsende Hinweise auf Schäden ignoriert. Ende 2022 erschütterte eine Welle von Klagen die Branche und legte eine der beunruhigendsten Realitäten offen: die Langzeitfolgen chemischer Haar-Glätter, die insbesondere Frauen — vor allem Schwarze Frauen — unter dem Banner der Sicherheit und „wissenschaftlichen“ Formulierung vermarktet wurden. Im Mittelpunkt steht die seit Jahrzehnten bekannte Marke „Dark & Lovely“ für strukturiertes Haar.
Die Produkte wurden als klinisch getestet, sanft und zur regelmäßigen Anwendung geeignet beworben — häufig untermauert durch dermatologische oder wissenschaftliche Anspielungen. Hinter dieser Sprache, so die Klagen, stehe jedoch ein Muster der Vernachlässigung. Laut zusammengeführten Verfahren vor dem U.S. District Court für den Northern District of Illinois entwickelten Frauen, die diese Relaxer über Jahre hinweg nutzten, Gebärmutterkrebs, Endometriose und weitere reproduktive Erkrankungen. Die Klagen verweisen auf eine NIH-Studie aus 2022, der zufolge Frauen, die häufig chemische Haar-Glätter verwendeten, mehr als doppelt so wahrscheinlich Gebärmutterkrebs entwickelten wie Nicht-Nutzerinnen. Die Klägerinnen werfen L’Oréal und anderen Herstellern vor, diese wachsende Evidenz ignoriert oder verschleiert zu haben und die Produkte weiterhin als „wissenschaftlich fortschrittlich“ und „dermatologisch getestet“ zu vermarkten. Kritiker:innen sehen darin ein Paradebeispiel für Science-Washing — die Autorität wissenschaftlicher Sprache wird genutzt, um Geschäftsinteressen zu schützen und rassifizierte Schönheitsideale zu zementieren. L’Oréal weist Fehlverhalten zurück und erklärt, die Produkte seien bei bestimmungsgemäßer Anwendung sicher. Die Klagen haben jedoch breitere Diskussionen über toxische Exposition, rassische Ungleichheit und den Missbrauch wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit im Beauty-Marketing befeuert. Für viele stellt sich die grundsätzliche Frage: Ab wann bedeutet „getestet“ nicht mehr „sicher“, sondern nur noch „vermarktet“?
„Klinische“ Beauty ohne klinischen Beleg: Zahlreiche High-End-Skincare-Marken, darunter Sunday Riley und Drunk Elephant, gerieten in die Kritik, weil sie „klinikähnliche“ Ergebnisse mit selektiven oder unveröffentlichten Daten bewarben. Teils dienten Studien auf Inhaltsstoff-Ebene als Beleg für die Wirksamkeit der Gesamtformel — ein klassischer Science-Washing-Trick. Der Begriff „klinisch“ verleiht Legitimität: Er evoziert Labore, kontrollierte Studien, weißgekittelte Expert:innen. In der heutigen Beauty-Industrie ist „clinical-grade“ jedoch ebenso Marketing-Attribut wie wissenschaftliches Label — und mehrere Luxusmarken wurden dafür kritisiert, diese Grenze zu verwischen. Ein Beispiel sind Sunday Riley und Drunk Elephant, zwei Kultmarken, die in sozialen Medien groß wurden. Beide bauten ihren Ruf auf „clean“, wissenschaftsgetrieben und ergebnisorientiert. Die Verpackungen sprechen die Sprache der Chemie: Peptide, Säuren, Antioxidantien. Die Websites verweisen auf „klinisch bewiesene Ergebnisse“ und „labortestete Formeln“. Untersuchungen und Watchdogs wiesen jedoch darauf hin, dass viele dieser Aussagen sich auf Studien zu einzelnen Wirkstoffen stützen — nicht auf die vollständigen Produktformulierungen. Ein Peptid oder ein Vitamin-C-Derivat kann isoliert Vorteile zeigen, doch in Kombination mit weiteren Stoffen (Konservierung, Duft, Stabilisatoren) können Effekte nachlassen oder unvorhersehbar interagieren.
Diese selektive Zitierung ist typisch für Science-Washing: Sie erzeugt einen Anschein von Evidenz, indem wissenschaftliche Belege herangezogen werden, die auf das beworbene Produkt gar nicht zutreffen. Anders als bei Arzneimitteln müssen Kosmetika keine klinischen Daten veröffentlichen — dadurch bleibt viel Spielraum für vage Formeln wie „klinisch getestet“ oder „bewiesene Ergebnisse“. Sunday Riley erlitt zusätzlich einen Reputationsschaden nach einem Vergleich mit der US-Verbraucherschutzbehörde FTC im Jahr 2019 wegen angeblich gefälschter Online-Bewertungen zur Verkaufsförderung auf Sephora.com. Zwar betraf dies nicht direkt Science-Washing, es schürte jedoch die Skepsis gegenüber Authentizität und Ehrlichkeit in der „klinischen“ Beauty. Drunk Elephant wiederum wird für Inhaltsstoff-Transparenz gelobt, aber für kühne „clinical-level“-Claims kritisiert, die nicht durch veröffentlichte Forschung gestützt sind. Expert:innen betonen, dass „clean“ oder „biokompatibel“ nicht gleichbedeutend mit wissenschaftlicher Validierung ist — oft handelt es sich um semantische Spiele, die gesundheitsbewusste, wissenschaftsaffine Konsument:innen ansprechen sollen, ohne tatsächliche Beweise zu liefern. Das Problem ist nicht Innovation, sondern deren Illusion. Echte klinische Validierung bedeutet unabhängige, peer-reviewte Tests an vollständigen Formulierungen — nicht an Wirkstoff-Bausteinen oder markenfinanzierten Mini-Studien. Solange Beauty-Unternehmen diesen Standard nicht erfüllen, bleibt „clinical-grade“ eher ein Versprechen als ein Beleg.
Für eine Branche, die sich auf Innovation beruft, wird der nächste echte Durchbruch nicht aus einem neuen Molekül oder Wunderserum entstehen — sondern aus der Wahrheit.

Wie man Science-Washing erkennt
Um Science-Washing zu erkennen, solltest du bei Formulierungen wie „klinisch erwiesen“, „wissenschaftlich getestet“ oder „von Dermatolog:innen empfohlen“ skeptisch sein, wenn keine Studie verlinkt oder zitiert ist. Prüfe, ob unabhängige Forschung vorliegt (nicht markenfinanzierte Tests), achte auf transparente Angaben zu Inhaltsstoffen und vollständige INCI-Listen und bevorzuge Marken, die ihren Prozess erklären – nicht nur ihre Versprechen.
Science-Washing ist nicht nur Marketing — es ist Manipulation. Es bedient unseren Wunsch nach Fakten, Sicherheit und Kontrolle. Wenn Marken Wissenschaft vortäuschen, verkaufen sie nicht nur falsche Hoffnung; sie untergraben auch das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaft selbst.
+ Hightlight Image:
© Nataliya Melnychuk via Unsplash