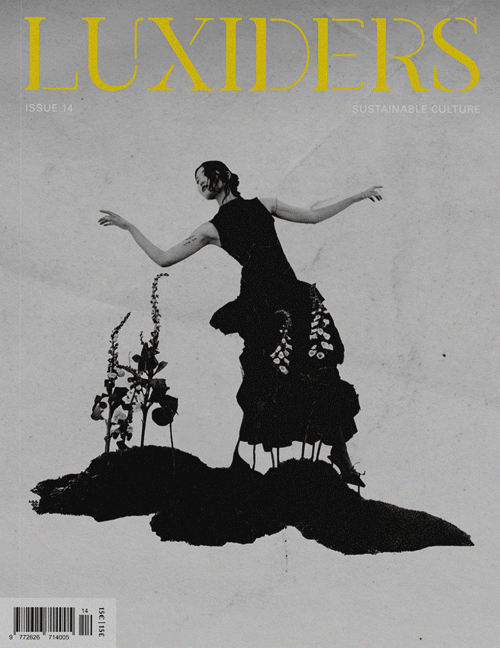DZHUS „Absolute“-Kollektion | Zwischen Trauma und Avantgarde-Kreationen
Zwischen Trauma und Schöpfung liegt DZHUS „Absolute“ – eine Fashion-Performance, die Schmerz in skulpturale Bedeutung übersetzt. Für die ukrainische Designerin Irina Dzhus ist dies nicht einfach eine Kollektion, sondern ein existenzielles Requiem: „Schnitte in Schnitten“, Trauer geschmiedet zu avantgardistischer Rüstung. Nach der Premiere auf der Berlin Fashion Week ist „Absolute“ nun im Jaga Hupało Space of Creation in Warschau zu sehen – ein visuelles Hymnus auf Erinnerung, Überleben und nie erlebtes Glück. Erfahre, wie Irina Dzhus zu diesem schöpferischen Zustand gelangte.
Vom Überleben zum Erzählen
Irina Dzhus’ Weg in „Absolute“ beginnt in der Dunkelheit. Nachdem sie sowohl dem Krieg als auch familiärem Missbrauch entkommen war, fand sie kurzzeitig Zuflucht – nur um in dieser vertrauten Sicherheit ihren tiefsten Ängsten zu begegnen. Ihr Überlebensmodus erwachte erneut. Die Designerin nutzte diese rohe, ungefilterte Energie und verwandelte sie in einen dringlichen kreativen Akt: eine Fashion-Performance, die spricht, wenn Musik verstummt.
Im Zentrum der Performance steht eine würfelförmige Bühne, deren Anker ein schlichter Stuhl ist. Auf dieser Bühne wird Irina zur Erzählerin, verwebt eine Kette aus Ereignissen, Empfindungen und Dialogen, die auf eine schmerzhafte Suche nach dem „Absoluten“ verweisen – nach einem Glück, das sie noch nie erlebt hat. Die Kleidung ist Erinnerung in Bewegung, sie wiederholt sich, mutiert, reflektiert. Die Silhouetten sind naiv starr und erinnern an modernistische Comics und spirituelle Ikonografie.
Accessoires werden zu Protagonisten: umfunktionierte Kopfbedeckungen, Schals,
Upcycling-Challenges – jedes erzählt seine eigene Mikrogeschichte. Die Technik verweist auf kintsugi (die japanische Kunst, mit Gold zu reparieren) und ehrt Beschädigungen, anstatt sie zu verbergen. Anatomische Symbolik durchzieht das Werk: Münder, die entweder rauchen oder rituell zugenäht sind; Hybride aus dekonstruiertem männlichem Gesicht und gealtertem weiblichem Körper; Kleidungsstücke, die nur funktionieren, wenn sich zwei Handschuhformen umarmen; ein Herrenmantel, der eine umarmende Frauenfigur birgt. Diese halbübernatürliche Silhouette wird untrennbar mit der Identität der Künstlerin verbunden – zugleich euphorischer Traum und lähmende Dystopie.
„Ich nehme Frauen als rätselhafte, ätherische Phänomene jenseits der offensichtlichen Logik wahr – und zugleich erstaunlich pragmatisch, diskriminierend und giftig gegenüber ihresgleichen.“ – Irina Dzhus.










„Mir wurde eine Erfahrung zuteil, die mir nicht nur den Atem nahm, sondern auch jede Fähigkeit zum Widerstand und jedes Bedürfnis nach Selbstbestätigung. Es war euphorisch beglückend, jemandem nahe zu sein, der ein ganzes Universum in sich trug – und neben dem ich nichts weiter sein konnte als ein Sandkorn, das schließlich zu Staub zerfällt.“ – Irina Dzhus.
Katharsis, Pflicht, Freiheit | Interview mit Irina Dzhus
Welches persönliche Trauma hat Sie dazu geführt, „ABSOLUTE“ zu erschaffen?
In dem Versuch, es ein für alle Mal zu verarbeiten – als eine Art „Re:How r u?“-Newsletter – habe ich eine 35-minütige Beichte aufgenommen, die ich als Soundtrack meiner Show auf der Berlin Fashion Week verwendete. Später begleiteten zentrale Ausschnitte daraus den achtminütigen Film. Musik schien unangebracht, doch es wäre schade gewesen, die eigenwillige Bildsprache der Kollektion unkommentiert zu lassen.
Um es kurz zu machen: Ich habe den Menschen meines Lebens gefunden – und verloren. Indem ich meinen Traum erfüllte, habe ich ihn aus meinem Lebensparadigma entfernt und damit verurteilt. Schließlich, gezwungen, noch eine Weile in der physischen Dimension zu bleiben, obwohl mein Bewusstsein das Trauma nie bewältigt hat, blieb mir keine andere Wahl, als den Traum zurückzuholen und einzufrieren, bis ich die Aufgaben erfüllt habe, für die ich hier bin. „ABSOLUTE“ ist eine kathartische Ode an jemanden, der – wie Wasser in seinen drei Aggregatzuständen – gewesen ist, geworden ist und bleiben wird: ein Traum, solange ich existiere. Ich ermutige alle Neugierigen, mehr in der Originalrede zu entdecken.
Wie ist es, Schmerz in Kunst zu verwandeln?
Es fühlte sich an wie eine Hinrichtung. Ich war schon nicht mehr in der Lage, normal zu arbeiten, die Trauer war unerträglich – einige Auftraggeber und Partner sagten sogar wegen meiner veränderten Haltung ab. Trotzdem musste ich die Marke am Leben erhalten und die saisonalen Veröffentlichungen finanzieren. Also bewarb ich mich weiter für das BFW-Stipendium, gewann es, entwarf Kollektionen und Shows, eine nach der anderen. Kein Sponsor hätte einfach mein Leben und meine spontane Kreativität unterstützt, bis ich „wieder normal“ wäre – die einzige verfügbare Finanzierung war an konkrete Projekte mit extremen Zeitrahmen gebunden. Dieser unaufhörliche Prozess wurde zugleich zu einer Flucht vor dem Problem, einer Pause seiner Auflösung. Am Ende war ich gezwungen zu erschaffen – und schließlich das Publikum mit meinem Schmerz zu unterhalten. Ich verfluchte dieses Zirkusspiel, besonders die Tatsache, als fröhliche Exzentrikerin wahrgenommen zu werden, basierend auf meinem übertriebenen Lächeln und den epischen Bewegungen. In Wahrheit schöpfte ich Kraft aus dem Erbe des Bharatanatyam: ein Tanz, in dem schmerzhafte, erschöpfende Gesten trainiert werden, um tiefere Bedeutungen zu vermitteln. Eine weitere große Inspiration war Dana International. Als Kind bewunderte ich ihre Entschlossenheit: Wenn sie ihr wahres Selbst entdecken und feiern konnte, andere mit ihrer Energie beschenkend, dann konnte ich es auch versuchen. Wenn diese Beispiele zu selten erscheinen – denken Sie an eine lachende Geisha: Ist sie wirklich fröhlich? Wovon wird ihre Körpersprache angetrieben und wem dient sie? Nun, da ich endlich gelernt habe, Projekte abzulehnen, die neue Produkte erzwingen, blicke ich zurück darauf, wie ich selbst die letzten Reste meiner Seele zerstörte und auf den Trümmern tanzte – und ich bin erschüttert, wie grausam ein verzweifelter Mensch zu sich selbst sein kann, wenn ihm keine helfende Hand gereicht wird.
Freiheit als Befreiung und Pflicht?
„Nein“ zu allem. Die Frage nach der Freiheit war der zentrale Punkt meiner mentalen Forschung im letzten Jahr. Denn die weitverbreiteten Deklarationen individueller Wahlfreiheit, mit denen wir bombardiert werden, bleiben zynischer Populismus, solange unterschiedliche Entscheidungen nicht mit Akzeptanz begegnet wird. Die aktuelle gesellschaftliche Agenda ist so hoffnungslos stigmatisiert, dass wir alle gezwungen sind, denselben existenziellen Kurs zu verfolgen. Unabhängig von unseren inneren Bedürfnissen werden wir ermutigt, um Unabhängigkeit zu kämpfen, Stärke zu kultivieren, am Leben zu bleiben – und idealerweise Feministinnen zu sein. Keine dieser Dogmen resoniert mit mir, und es ist frustrierend, selbst in Trauer vorgeben zu müssen, in diese Schablonen zu passen, nur um einer sozialen Auslöschung zu entgehen, der ich bereits erlegen bin.
Nach einer 15-jährigen Leere einer koabhängigen Beziehung, in der mich mein Stolz dazu trieb, Quasi-Erfolge wie Unabhängigkeit, Selbstermächtigung, verantwortungsbewusste Entscheidungen und Talentverwirklichung zu kultivieren, war ich keinen einzigen Tag wirklich glücklich. Bis ich zufällig auf eine Gelegenheit stieß, mich „von der Freiheit zu befreien“ – mein bisher einziger Moment wahren Glücks. Ich erlebte etwas, das mir nicht nur den Atem nahm, sondern auch jede Fähigkeit zum Widerstand und jedes Bedürfnis nach Selbstbestätigung. Es war euphorisch beglückend, jemandem nahe zu sein, der ein ganzes Universum in sich trug – und neben dem ich nichts weiter sein konnte als ein Sandkorn, das schließlich zu Staub zerfällt. Für einen Moment löste er meine Zwangsstörung auf und schenkte mir die seltene Möglichkeit, mich ihm ganz anzuvertrauen.
In diesem Zusammenhang – und natürlich geprägt durch meine schwierige Kindheit – liegt meine einzige Komfortzone am Rand der Selbstidentifikation, in einer süchtig machenden Abhängigkeit, frei von der Last der Wahl.
Was die Identität betrifft: Als nicht-binäre Person habe ich persönlich keine Verbindung zur Weiblichkeit – außer in sexueller Hinsicht. Ich nehme Frauen als rätselhafte, ätherische Phänomene wahr, jenseits der Logik, und zugleich erschreckend pragmatisch, diskriminierend und giftig gegenüber ihresgleichen. Meine Standardemotion Frauen gegenüber im Alltag ist respektvolle Nachsicht, doch meine stille Resistenz wird ständig auf die Probe gestellt. Ich fühle mich in weiblichen Kontexten fremd, während männliche Gesellschaft – ob 15 oder 70 Jahre alt – mich emotional befreit, sei es durch albernen Humor oder Diskussionen über Quantenmechanik.
Was Sexualität betrifft, so bin ich neurobiologisch ein Hybrid aus männlichen Herangehensweisen und weiblichen Obsessionen. Meine Weiblichkeit zeigt sich nur gegenüber dem einen Mann, den mein Herz aus der Gesellschaft heraushebt, dessen Charisma stark genug ist, um die Dominanz meiner maskulinen Selbstwahrnehmung zu neutralisieren – und mich damit sanft zu zerstören. Dann scheint der natürliche Verlauf unumstößlich, und ich frage mich, was eine Frau dazu bringen kann, auf ihre Zartheit und das Bedürfnis, umsorgt zu werden, zu verzichten. Warum sollte ich gegen solch ein seltenes Privileg protestieren? Als 163 cm große biologische Frau finde ich es absurd, mit der majestätischen männlichen Physis konkurrieren zu wollen. Dennoch muss ich es – und sehe dabei wahrscheinlich lächerlich aus. Es sind erzwungene Maßnahmen, auf die ich nicht stolz bin und die ich nicht mit Weiblichkeit assoziiere. Ich würde sie sofort ablegen, wenn ich die weibliche Rolle ganz annehmen könnte. Mit anderen Worten: Groteske plus Aggression ergibt Minus Frau. Wenn man zu solchen Maßnahmen greifen muss – dann sollte man aufhören, Weiblichkeit zu beanspruchen, bis man wieder fähig ist, das „Ätherische im Urhaften“ zu ehren.
Ein weiteres schmerzhaftes Thema ist Pflicht. Seit meiner Kindheit – in meiner beruflichen Laufbahn und nun im Krieg – wurde von mir erwartet, mein Potenzial als Trägerin genialer Kreativität und „vorbildlicher Bürgerschaft“ zu erfüllen, ohne Raum für eigene Wünsche. Wie ein Pawlowscher Hund reagiere ich automatisch und tue mich schwer, zu erkennen, was ich wirklich will. Mein Gehirn sucht unablässig nach Optimierungen. Doch als ich nach großem Leid, mit herausgerissenem Herzen, nur noch sterben wollte, wurde mir selbst das verwehrt – meine Pflicht ließ mich nicht los. Es war erschütternd zu begreifen, wie viele Menschen „leben müssen“ statt „leben wollen“. In meinem Fall waren die Gründe banal: Ich bin das einzige Kind zweier älterer Frauen – meiner Mutter und meiner Tante – deren Welt sich um mich dreht. Außerdem leite ich DZHUS allein, und solange ich nicht delegieren und ein Erbesystem aufbauen kann, bin ich dazu verdammt, ihr zu dienen.
Zusammengefasst: Aus heutiger Sicht erscheinen mir „Unabhängigkeit“, „Freiheit“ und „Pflicht“ wie Strafen mit unerträglicher Verantwortung und endlosen Aufgaben. Die einzige „Befreiung“, nach der ich mich sehne, ist die von Entscheidungen – die Freiheit, einfach zu existieren oder nicht, nur weil ich es so will.
Kleidungsstücke als Produkte von Emotionen?
Und umgekehrt. „Emotionen als Produkte von Kleidungsstücken“ beschreibt mein Designverständnis gut. Zeitgenössische Kleidung soll lehren und leiten, motivieren und heilen. Sie entsteht als maßgeschneiderte Formel, um Lücken zu füllen und Reflexionen anzuregen. Das richtige Kleidungsstück ist Begleiter, Haustier, Spiegel, Tagebuch, Orakel, Bewunderer, Berater – und mehr. Ein multifunktionales Kleidungsstück hebt diese Verbindung auf eine neue Ebene: Es reagiert nicht nur auf Zustände, sondern kann das Sein selbst verändern. Nach diesem Akt radikaler Selbstoffenbarung – was bleibt? Ein kleines Stück Hoffnung 🙂 Träume werden Träume bleiben.
Nach diesem Akt radikaler Selbstoffenbarung – was bleibt?
Ein kleines Stück Hoffnung 🙂 Träume werden Träume bleiben.
„Ich blicke zurück und sehe, wie ich selbst die Überreste meiner Seele zerstörte und auf den Trümmern tanzte – und ich bin zutiefst erschüttert darüber, wie grausam ein verzweifelter Mensch zu sich selbst sein kann, wenn ihm keine helfende Hand zur Seite steht.“ – Irina Dzhus.














„Absolute“ ist nicht nur eine Kollektion, sondern ein Konzept. Die Kleidungsstücke sind wandelbar, veränderlich. Silhouetten entwickeln sich weiter, Elemente wiederholen sich, und die Erzählung spielt sich in wechselnden Formen erneut ab. Schwarz, Weiß, Nude- und Ecru-Töne dominieren – Farbe ist zweitrangig gegenüber Textur, Struktur und Symbolik.
Das Schlüsselstück: ein übergroßer Herrenmantel mit der eingearbeiteten Silhouette einer umarmenden Frau – ein körperliches Echo auf Irinas obsessive Beziehung zu ihrer eigenen Protagonistin. Dieser Mantel ist nicht nur ein Kleidungsstück, sondern Spiegel und Emblem zugleich.
Für Irina Dzhus ist „Absolute“ lebensbestimmend. Aus dem Schmelztiegel von Schmerz und Ohnmacht entstand eine rebellische Explosion von Kreativität. Sie bestätigte sich selbst: So tragisch es auch sein mag, sie wird ihre schöpferische Kraft niemals verlieren. Dieses Paradox – Segen und Fluch zugleich – verankert ihre Identität und stellt die Freiheit der Wahl selbst infrage.
Entstanden Anfang 2024, wurde „Absolute“ zu Dzhus’ kathartischem Vektor. Seitdem hat die Marke eine audiovisuelle Kampagne entwickelt, um die Botschaft zu verstärken. Dieses Projekt zeigt nicht einfach Kleidung – es inszeniert ein Ritual der Selbsterkenntnis, des Traumas und der Transzendenz.
All Images:
© Courtesy Dzhus