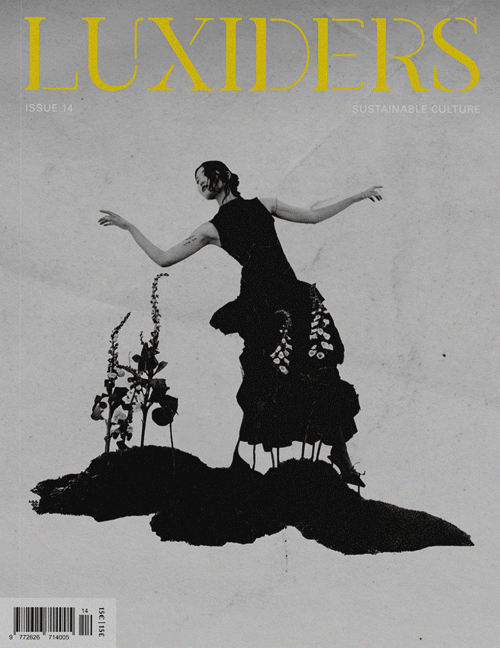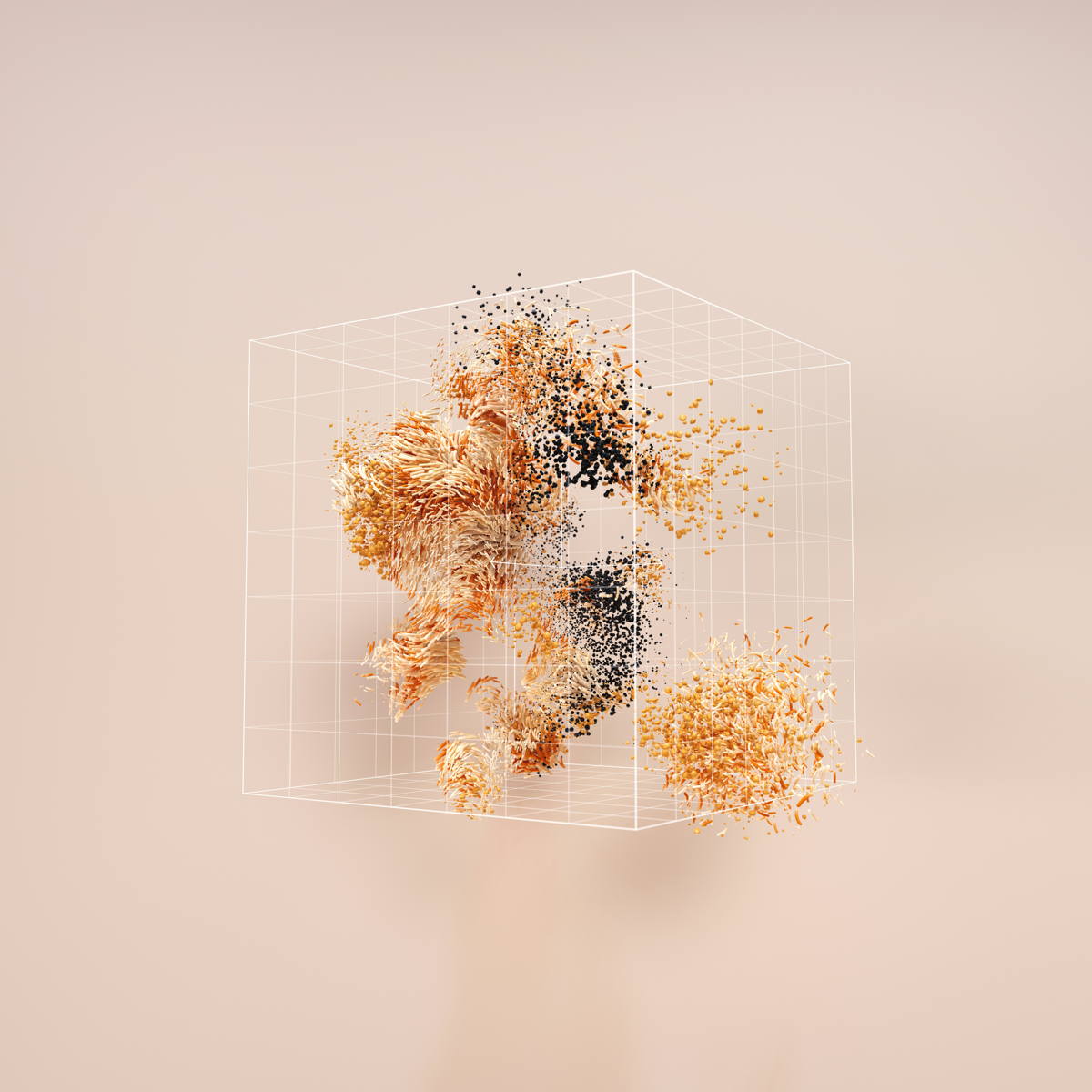
Die versteckte Verschmutzung der KI | Warum „saubere Algorithmen“ ein Mythos sind
Künstliche Intelligenz fasziniert mit ihrem Versprechen: schnellere Erkenntnisse, intelligentere Automatisierung, kreative Werkzeuge auf Knopfdruck. Doch hinter den Kulissen hinterlässt sie eine dunklere Spur – enormen Energieverbrauch, Wasserknappheit, Elektroschrott und sogar gesundheitliche Belastungen. Wenn wir die ökologischen Kosten der KI nicht angehen, riskieren wir, eine der wenigen technologischen Revolutionen zu untergraben, die uns eigentlich beim Kampf gegen den Klimawandel helfen könnte. Hier sind die tieferen Gründe, warum KI der Umwelt schadet – untermauert durch Fakten, Expert:innenwarnungen und mögliche Lösungswege.
Gigantischer Energieverbrauch und hohe CO₂-Emissionen
KI ist ein Werkzeug mit enormem Potenzial, um uns bei der Lösung von Klimawandel, Krankheiten, wissenschaftlichen Entdeckungen und mehr zu helfen. Aber wir müssen aufhören, sie als „grün von Natur aus“ darzustellen. In ihrer Infrastruktur stecken reale Verschmutzung, Ressourcenbelastung und Ungerechtigkeit.
Das Training großer KI-Modelle ist energieintensiv. In der Harvard Business Review berichten Shaolei Ren und Adam Wierman, dass das Training eines einzelnen großen KI-Modells Tausende Megawattstunden Strom verbrauchen und Hunderte Tonnen CO₂-Emissionen verursachen kann. Einige Schätzungen besagen laut How Companies Can Mitigate AI’s Growing Environmental Footprint, dass der Betrieb eines großen KI-Modells über seine Lebensdauer mehr CO₂ emittieren kann als ein Standardauto.
Ein Artikel von MIT News – Explained: Generative AI’s environmental impact – hebt hervor, dass generative Modelle (wie ChatGPT) enorme Rechenleistung erfordern – und dass die Inferenz (das Beantworten von Nutzeranfragen) ebenfalls einen kontinuierlichen Energieverbrauch verursacht. In den USA verbrauchten 2.132 Rechenzentren über 4 % des nationalen Stroms, erzeugten mehr als 105 Millionen Tonnen CO₂e und wiesen eine um 48 % höhere Kohlenstoffintensität als der US-Durchschnitt auf. Wenn immer mehr KI-Modelle trainiert, nachtrainiert und stark genutzt werden, wächst der Energiebedarf schneller, als viele Netze und erneuerbare Systeme mithalten können.
Im Bereich der KI brauchen wir neue Maßstäbe: Umweltverträglichkeitsprüfungen, Regulierung, offene Standards und eine Ingenieurskultur, die Nachhaltigkeit ebenso hoch bewertet wie Leistung.
Wasserverbrauch und Kühlverluste
Es geht nicht nur um Strom – die KI-Infrastruktur stützt sich häufig stark auf Wasser, um Server zu kühlen und sie vor Überhitzung zu schützen. Die Studie Uneven Distribution of AI’s Environmental Impacts weist darauf hin, dass Rechenzentren enorme Mengen an Süßwasserverdunstung benötigen, um Wärme abzuführen. In Environmental Impact of Artificial Intelligence wird geschätzt, dass KI-Betriebe bis 2027 zwischen 4,2 und 6,6 Milliarden Kubikmeter Wasser verbrauchen könnten – mehr als die Hälfte des jährlichen Wasserverbrauchs des Vereinigten Königreichs.
Eine wegweisende Studie mit dem Titel Holistically Evaluating the Environmental Impact of Creating Language Models ergab, dass nicht nur das Training, sondern bereits die Entwicklungsphase eines Modells – also Datensammlung, Architekturdesign und Tests – rund 50 % der gesamten CO₂-Emissionen verursachte und Millionen Liter Wasser verbrauchte.
Innovationen bei der Kühlung – etwa Flüssigkühlung statt Luftkühlung – können helfen: Forschungen zeigen, dass Flüssigkühlung die Emissionen um bis zu 50 % senken, nahezu null Wasserverbrauch ermöglichen und die Gebäudefläche reduzieren kann. In dürregefährdeten Regionen kann der Wasserbedarf jedoch katastrophale Folgen haben – lokale Ökosysteme und Menschen zahlen den Preis.
Googles eigene Behauptung, dass eine typische KI-Textanfrage nur „fünf Tropfen Wasser“ (0,26 ml) und 0,24 Wattstunden verbrauche, stieß auf Kritik: Expert:innen argumentieren, dass diese Angabe den tatsächlichen Systemverbrauch unterschätzt, den indirekten Wasserverbrauch ignoriert und Skaleneffekte verschleiern könnte.

Elektroschrott und andere versteckte Kosten der KI
KI verlangt mehr als Rechenzyklen
Sie verlangt Spitzentechnologie – und die verursacht vorgelagerte Umweltkosten: GPUs (Grafikprozessoren), ASICs und Spezialchips werden mit seltenen Metallen, intensivem Bergbau und toxischen Chemikalien hergestellt. Während sich Modelle weiterentwickeln, rüsten Unternehmen häufig auf und ersetzen ältere Hardware – das treibt den globalen Elektroschrott (E-Waste) an. Artificial Intelligence and the Environment der University of Delaware nennt E-Waste als gravierenden Faktor: Komponenten enthalten Quecksilber, Blei und Cadmium – gefährlich für Böden und Gewässer. Die Umweltlast entsteht nicht nur im Betrieb, sie ist entlang der gesamten Kette „eingebacken“ – vom Abbau bis zur Entsorgung.
Der KI-Fußabdruck trifft nicht alle gleichermaßen
Einige Gemeinschaften leiden stärker, vor allem jene, die bereits unter Druck stehen. Eine Studie „The Unpaid Toll: Quantifying the Public Health Impact of AI“ argumentiert, dass Emissionen aus KI (Herstellung, Betrieb und Entsorgung) die Luftqualität durch Feinstaub verschlechtern und dadurch Gesundheitslasten verursachen. Die Autor:innen schätzen, dass US-Rechenzentren im Jahr 2030 öffentliche Gesundheitskosten von über 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr verursachen könnten. Reuters berichtete, dass zwischen 2020 und 2023 die indirekten Emissionen großer Tech-Konzerne (getrieben durch KI-Infrastruktur) um 150 % gestiegen sind – angetrieben von energiehungrigen Rechenzentren. Das Smithsonian Magazine warnt, dass mit zunehmender KI-Nutzung mehr weitläufige Rechenzentren entstehen, fossile Energienetze länger bestehen und Wasserverbrauch sowie Emissionen zunehmen werden. Umwelt- und Gesundheitskosten sind oft „Externalitäten“, die nicht von KI-Unternehmen selbst getragen werden, sondern von Anwohner:innen – häufig in einkommensschwachen oder marginalisierten Regionen.
Rebound-Effekt & Jevons-Paradoxon
Effizienzsteigerungen helfen der Umwelt nicht zwingend, wenn die Nutzung explodiert. Das Jevons-Paradoxon besagt, dass eine Technologie mit steigender Effizienz (geringere Kosten pro Nutzung) oft stärker genutzt wird – wodurch Gewinne wieder verpuffen. AP News weist darauf hin, dass eine einzige KI-Suche bis zu 23-mal mehr Energie verbrauchen kann als eine typische Google-Suche; je stärker KI eingebettet ist, desto größer werden diese Energiekosten. Googles eigene Behauptung, eine typische KI-Texteingabe verbrauche nur „fünf Tropfen Wasser“ (0,26 ml) und 0,24 Wattstunden, stieß auf Kritik: Expert:innen werfen vor, dass sie den breiteren Systemverbrauch unterschätzt, indirekten Wasserverbrauch ignoriert und Skaleneffekte verschleiern könnte. Effizienz allein reicht nicht. Wird KI allgegenwärtiger, kann der Gesamtschaden für die Umwelt trotzdem steigen.
„Eine einzige KI-Suche kann bis zu 23-mal mehr Energie verbrauchen als eine gewöhnliche Google-Suche – und je stärker KI in unseren Alltag integriert wird, desto weiter steigen diese Energiekosten.“
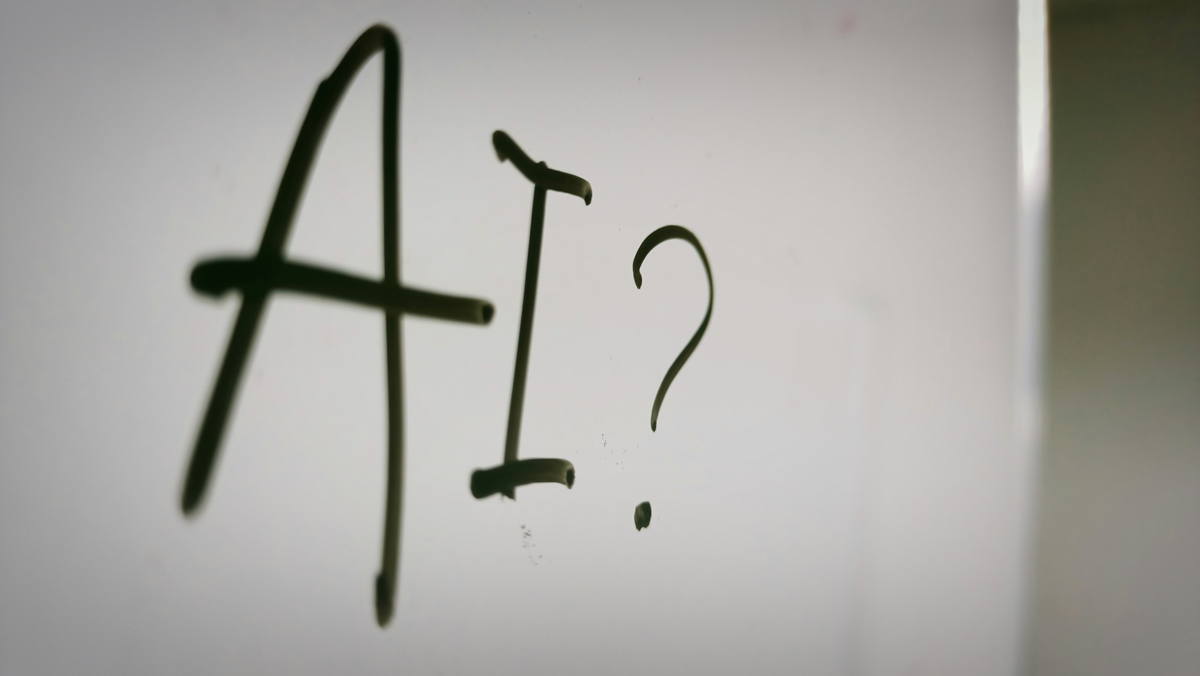
Nenne es nicht nachhaltig, wenn du es nicht beweisen kannst
KI ist nicht von Natur aus böse, aber wir müssen strenge Leitplanken, Transparenz und nachhaltige Designs einführen. Einige mögliche Ansätze:
Das britische National Engineering Policy Centre fordert eine verpflichtende Offenlegung des Energie- und Wasserverbrauchs in Rechenzentren. Diese sollten sich an grünen Architekturen und „Green AI“-Prinzipien orientieren – also Modelle entwickeln, die kleiner, effizienter und innerhalb klar definierter ökologischer Kostenlimits validiert sind. Außerdem sollten wir Methoden nutzen, die Berechnungen teilen oder wiederverwenden, anstatt Modelle jedes Mal von Grund auf neu zu trainieren.
Ein weiterer Ansatz ist SHIELD – ein Framework, das Kohlenstoff-, Wasser- und Energieverbrauch über geografisch verteilte Rechenzentren hinweg gemeinsam optimiert und Reduktionen von bis zu dem 3,7-Fachen bei CO₂ und dem 1,8-Fachen beim Wasserverbrauch im Vergleich zum Status quo zeigt.
Wir sollten von Luft- auf Flüssigkühlung umsteigen, was Emissionen und Wasserverbrauch drastisch senken kann. Ebenso wichtig ist die Rückgewinnung von Abwärme – etwa zur Beheizung von Gebäuden oder Universitäten, wie beim Aquasar-Projekt.
Rechenzentren sollten dort angesiedelt werden, wo erneuerbare Energien reichlich vorhanden und die Stromnetze sauber sind. Gleichzeitig gilt es, die direkte Nutzung von Solar-, Wind-, Wasser- oder sogar Kernenergie zu fördern. Auch die Stärkung der Netzstabilität ist entscheidend – KI-Leistungsspitzen überlasten häufig Stromnetze und erhöhen die Abhängigkeit von fossilen Reservequellen. Schließlich müssen wir nicht nur das Training von Modellen betrachten, sondern auch die ökologischen und gesundheitlichen Auswirkungen von Hardwareproduktion, Transport, Entsorgung und Infrastruktur mit einbeziehen.
Hightlight Image:
© Unsplash